Was muss mein Bergsteigerhelm eigentlich können?
Viele unterschätzen die Gefahr von oben, sei es eine fallen gelassene Expresschlinge, das Smartphone von der vorderen Seilschaft, welches für das Actionselfie noch gerade in den Händen eines Vorsteigers war, oder von einer Gemse oder Steinbock gelöste Steine die den Berg herunter donnern. Da der Kopf nun Mal zuoberst ist muss dieser dementsprechend auch geschützt werden. In vielen Klettergärten und Klettersteige kann man mehr oder weniger Erfahrene welche ohne Kopfschutz oder bei Klettersteide sogar ohne Sicherung unterwegs sind beobachten. Dies ist nicht nur fahrlässig sondern auch ein eher schlechtes Vorbild für Anfänger, welche so ein völlig falsches Bild der Sicherheit beim Bergsteigen vermittelt bekommen. Auch wenn vielleicht ein Helm warm gibt, ist man bestimmt nicht cooler ohne Helm, oder behält so einen kühleren Kopf. Mal von den versicherungstechnischen Probleme bei einem Unfall abgesehen. Selbst im Winter ist dringend abzuraten ohne Helm zum Beispiel im Steileis unterwegs zu sein, da die Schläge mit den Eisgeräten gerne Mal mehr oder weniger grosse Brocken lösen, die dann im dümmsten Fall direkt auf den Kletterer hinunterfallen. Dabei muss ich sagen, dass mir dies trotz meines Helmes leider nicht ganz erspart blieb. Will man den Helm auch im Winter nutzen ist darauf zu achten, dass genügend Platz für eine dünne Mütze bleibt.
Im Prinzip müssen die Bergsteigerhelme (nicht verwechseln mit Skitourenhelme-> andere Zertifizierung) drei Grundfunktionen erfüllen:
-
er muss das Durchdringen von spitzen oder kantigen Gegenständen verhindern
-
er muss die Stoßbeanspruchung durch Energieaufnahme dämpfen
-
er muss hohe, lokale Beanspruchung des Schädels vermeiden
Welche Helmtypen gibt es?
Hartschalenhelme bestehen aus einer harten Schale, unter der sich meist ein Flies oder ein Gurtsystem befindet, wie sie auch in Bauhelme zu finden sind. Die Vorteile des Hartschalenhelmes sind seine Robustheit, unanfällig für Schäden beim Transport im oder am Rucksack muss er zum Beispiel sollte er Mal ein wenig gröber behandelt werden, nicht zwingend ersetzt werden. Er gehört jedoch zur schwersten Helmart und ist meistens etwas weniger gut belüftet. Die Wirkungsweise der Hartschalenhelme ist einfach, sie verteilen die Energie eines Aufpralls über die ganze Schale, bevor diese erst über das Gurtsystem an den Kopf weitergeleitet wird.
Inmold-Helme oder Schaumschalenhelme bestehen komplett aus hochwertigem Styroporschaum (EPS/EPP). Manche sind wie bei Fahrradhelme zum Schutz des Styropors mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen, oder besitzen auf der Oberseite einen rudimentären Steinschlagschutz. Sie sind zwar besonders leicht, der Nachteil ist aber, dass sie anfälliger auf Schäden während dem Transport sind. Sie nehmen die Energie eines Aufpralls durch Verformung und Brechen auf.
Hybridhelme nutzen die Vorteile beider Bauformen entweder ganz oder teilweise. Sie besitzen eine etwas dünnere Schale aus Polyester, Polycarbonat, ABS, Nylon, Kevlar, Dyneema oder Carbon, in denen entweder ein Stossabweisendes Material meist EPS oder das weniger Empfindliche EPP eingearbeitet wird. Der Vorteil von EPP liegt auf der Hand, denn es kehrt bei einer Belastung immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Kannst du also, wenn du mit einem deiner Finger in deinem Helm drückst einen Abdruck hinterlassen, so besteht das Innenleben deines Helmes aus EPS. Ist es nicht möglich wird es mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit EPP sein.

Hartschalenhelm von Uvex den Pheos Alpine

Der Petzl Meteor einen leichten Inmold-Helm von Petzl

Der Hybridhelm Petzl Boreo
Wie soll man nun den richtigen Helm finden?
Viele wählen den Helm aufgrund des geringen Gewichts, der Marke oder der Farbe aus, das ist nicht grundsätzlich falsch. Wichtiger ist aber vor allem, dass der Helm auf die jeweilige Kopfform passt. Der Helm sollte gut sitzen und nicht vom Kopf fallen, ausserdem sollte sich keine grosse Lücke zwischen Kopf und Helm befinden (meistens mit den Finger durch die Belüftungsschlitze spürbar). Ein stylischer Helm nützt nichts wenn er nicht passt, oder nur am Rucksack hängt, du wirst also kaum einen Helm kaufen können, ohne ihn vorher anprobiert zu haben! Im Fachgeschäft wirst du mit Hilfe der Beratung bestimmt den passenden Helm für deinen Kopf finden.
Im Prinzip spielt es auch keine grosse Rolle aus welcher Kategorie man sich einen Helm aussucht, denn alle erfüllen dabei die selben Normen. Einerseits die Europäischen Norm EN 12492-2012, oder sogar die etwas strengere Norm UIAA 106. In diesen ist die Wirksamkeit des Tragesystem, die Anforderung Stösse und Aufprall aufzunehmen sowie die Durchdringungsfestigkeit wie folgt definiert:
- Stossdämpfung: max. auf den Kopf übertragene Kraft 10kN (UIAA 106 max. 8KN)
- Durchdringung: keine Berührung der Spitze des Prüfkörpers mit dem Kopf
- Wirksamkeit der Trageeinrichtung: kein Herunterfallen möglich
- Festigkeit der Trageeinrichtung: kein Reissen, max. Dehnung von 25mm
Aufprallschutz bei Bergsteigerhelme
Stimmen aus den USA wurden schon vor einiger Zeit laut und forderten, dass Bergsteigerhelme gezielt auch auf den Schutz vor einer Aufprallverletzung ausgelegt sein sollten. Untersuchungen von Unfalldaten aus den USA und der Schweiz hatten ergeben, dass Aufprallverletzungen aus Stürzen 12 Mal häufiger vorkommen als Verletzungen durch herabfallende Gegenstände. Die anschliessenden Tests lieferten erstaunliche Ergebnisse. Bei einem Sturz, bei dem die Beine zuerst auf dem Boden treffen und der Körper nach hinten kippt, war die auf den Kopf wirkende Kraft durch die Rotationsbewegung grösser als bei einem senkrechten Sturz aus gleicher Höhe. Einzig der Inmold-Helm konnte einen einigermassen ausreichenden Schutz gegen Aufprall gewährleisten. Beim gestesteten Hartschalenhelm war die Krafteinwirkung sogar grösser als ohne Helm. Beim getesteten Hybridhelm war das herausstehende Daumenrad am Hinterkopf eine Quelle für Verletzungen.
MIPS bei Bergsteigerhelme - Sinn oder Unsinn?
Die Bergsteigerhelme sind wie wir gerade gesehen haben also nicht primär für den Schutz vor Aufprallverletzungen konzipiert, sondern in erster Linie für den Schutz gegen herabfallende Gegenstände! Es gibt Bergsporthelme die zum Beispiel auch eine Doppelzertifizierung einerseits für das Klettern, andererseits für das Skitourengehen oder Skibergsteigen besitzen. Diese schützen daher besser vor einem Aufprall, da diese Szenarien bei der Prüfung bereits berücksichtigt werden müssen. In anderen Sporthelme existiert bereits seit einigen Jahren das MIPS-System (Multidirectional Impact Protection System) um genau dieses Phänomen auf ein Minimum zu reduzieren. Es ist also denkbar, dass sich in Zukunft MIPS-Helme oder Helme mit vergleichbaren Systeme wie auch bei anderen Sportarten durchsetzen werden. Das MIPS-System ist zwar teuer, ein MIPS-Helm kostet im durchschnitt etwa 70chf mehr als ohne MIPS, ist aber alles andere als nur Geldmacherei und kann für Sicherheitsfanatiker eine sinnvolle Investition darstellen.
Lebensdauer meines Helmes
Die Lebensdauer eines Helms hängt stark vom Einsatz ab. Er sollte aber gemäss Norm, bei jeder ernsthafte Krafteinwirkung aus dem Verkehr gezogen und ersetzt werden. Selbst bei einer kleinen Beschädigung zum Beispiel beim herunterfallen auf dem Boden oder beim versehentlichen Sitzen auf dem Rucksack, ist möglicherweise die einwandfreie Funktion des Helmes beeinträchtigt. Hat der Helm selbst nach mehreren Jahren immer noch nichts abgekriegt und wurde korrekt gelagert, gibt es keinen Grund diesen zu ersetzten. Dennoch empfehlen die Hersteller den Ersatz eines Helmes nach etwa fünf Jahren, aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses des Materials durch Temperaturunterschiede, UV-Einstrahlung oder auch den Schweiss des Trägers. Wieder ein Mal muss jeder für sich entscheiden wie wichtig ihm oder ihr seinen Kopf ist. Ausserdem sollte auf das Malen, sowie das Aufbringen von Sticker auf dem Helm verzichtet werden. In Jedem Helm findet man das Herstellungsdatum sowie einige interessante Infos wie zum Beispiel das Gewicht, das Material oder die Zertifizierung des Helmes.
Actioncam-Halterungen an Helme
Das Anbringen einer Actioncam wie GoPro und Co., ist für viele heutzutage ein absolutes Muss um die Outdoorabenteuer lebendiger einzufangen als auf einem einfachen Foto. Für andere ist das bloss Selbstdarstellung, um in den Sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Nicht selten, werden auch um spektakuläre Bilder zu erreichen waghalsige Aktionen durchgeführt und deutlich höhere Risiken in Kauf genommen - man will ja schliesslich auf Youtube auffallen.
Das ganze ist denkbar einfach: Halterung her und auf dem Helm geklebt, dann nichts wie raus an die Wand oder die Piste!
Doch wie ist das eigentlich mit der Sicherheit? Helme werden so designt, dass sich weder Scharfe Kanten am Helm befinden noch irgendwelche Teile des Helms, bei einem Aufprall den Träger verletzen könnten. Eine GoPro-Halterung ist eben so ein Gegenstand welches hervorsteht und bei einem Aufprall eine punktuell grössere Belastung auf die Helmaussenschale hervorrufen kann (->Schwächung der Schale). Es kann also theoretisch und auch praktisch passieren, dass es bei einem ungüstigen Aufprall zu schlimmeren Verletzungen durch die Halterung kommt. Wie es zum Beispiel mit grosser Wahrscheinlichkeit der Fall war beim Formel-1 Fahrer Michael Schumacher, bei einem Sturz beim Skifahren.

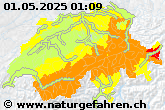

Kommentar schreiben